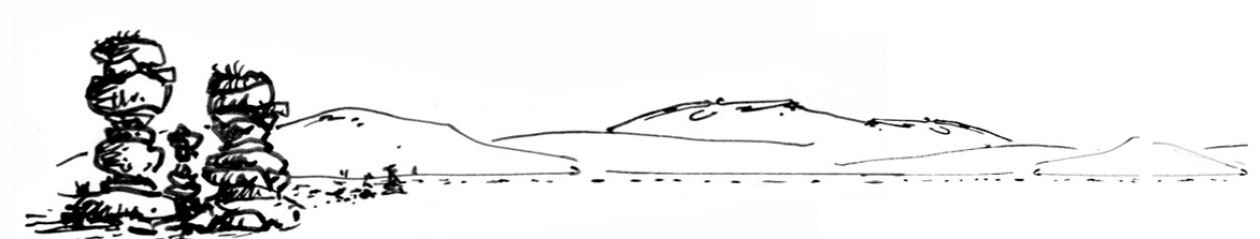I. Königin Hortense nimmt Kurs auf Reykjavík
I. Königin Hortense nimmt Kurs auf Reykjavík
Da staunten die Reykjavíker nicht schlecht: La Reine Hortense und Le Cocyte tauchten am Horizont auf und gingen in der Bucht vor Anker. Isländer der Jetztzeit denken sofort an Kreuzfahrtschiffe, zu groß um im Hafen anlegen zu können, schwimmende Hochhäuser mit tausenden von Kreuzfahrern, die nach der Ausbootung Reykjavík, aber auch kleinere Hafenstädte wie Akureyri oder Ísafjörður heimsuchen.

Doch in der Zeit, in der diese Saga handelt, gab es noch keinen Hafen in Reykjavík. Das Städtchen zählte kaum 1.500 Einwohner und sein einziges aus Stein erbautes Gebäude war die Domkirkja.
Vor 161 Jahren, Anfang Juli des Jahres 1856, liefen nacheinander zwei große Segler, randvoll beladen mit Kohle und Proviant, in den Faxafloi ein. Ihnen folgten zwei imposante Dampfschiffe, bei denen es sich trotz der blumigen Namen La Reine Hortense und Le Cocyte um französische Kriegsschiffe handelte. Sie wurden von der bereits zuvor angekommenen l’Arthémise mit 21 Kanonenschüssen begrüßt, die am Hausberg Esja widerhallten und bei einem älteren Einwohner Reykjavíks einen Hörsturz verursachten.
Doch was sich irgendwie auf den Beinen halten konnte, hatte sich in Schale geworfen, stand am Ufer und jubelte den ankommenden Fremden zu. Diese blickten mit wachsender Ernüchterung auf das, was die Hauptstadt Islands darstellen sollte. Neben dem Anwesen des dänischen Gouverneurs gab es nur eine Handvoll ansehnlicher Gebäude, ansonsten war die Stadt eine Ansammlung ärmlicher Fischerhütten, baumlos und ohne Gärten. „C’est triste, morne, désolé!‟

Das notierte Edmund Chojecki, ein in Frankreich lebender polnischer Journalist und Schriftsteller. Er hatte für sozialistische Zeitungen geschrieben, war aus Frankreich ausgewiesen worden, hatte am Krimkrieg teilgenommen, war aber nun Sekretär des Expeditionsleiters an Bord der Korvette La Reine Hortense und verfasste wissenschaftliche Notizen über die Expedition, die ein Jahr später unter dem Pseudonym Charles Edmond veröffentlicht wurden.
Ein Boot näherte sich der Korvette, und an Bord kletterten die städtischen Honoratioren, ‒ Gouverneur, Bürgermeister und Geistlicher ‒ um dem Expeditionsleiter ihre Aufwartung zu machen. Denn dieser war keine Geringerer als Prinz Napoléon, der Sohn von Jérôme Bonaparte, dem ehemaligen König von Westphalen. Der amtierende Kaiser Napoleon III. hatte seinen Cousin auf Eismeerexpedition geschickt, oder besser gesagt: abgeschoben, denn im gerade zu Ende gegangenen Krimkrieg hatte sich Prinz „Plon-Plon‟ nicht gerade als Vorbild für die Truppe erwiesen.
Doch das war den Reykjavíkern egal: Sie fühlten sich durch den Besuch hoch geehrt, zumal der Prinz sich alsbald an Land setzen ließ, um das offizielle Besichtigungsprogramm ‒ Dómkirkja, Kirchgarten, Lateinschule, Druckerei, Bankettsaal, Apotheke und gar ein Handelshaus ‒ zu absolvieren. Anschließend zog er sich mit Gouverneur Trampe zu nicht öffentlichen Gesprächen an den Elliðavatn zurück. Abends schmiss Trampe im Garten seiner Residenz ein Bankett vom Allerfeinsten. Die Sprache, in der sich die gebildeten Bürger Reykjavíks (und deren gab es trotz der schlichten Behausungen doch verhältnismäßig viele) fließend mit ihren weltgewandten Gästen unterhalten konnten, war ‒ Latein.

Unermüdlich trieb der Sekretär des Prinzen unterdessen Studien über Land und Leute, glotzte in jedes Fenster wie heutzutage die Kreuzfahrer, ja, scheute sich nicht, die elendste Fischerhütte zu betreten, um sie wortreich beschreiben zu können. Damals gab es noch keine Benimm-Broschüren für Schiffsreisende, in denen sie in charmanten Comics darauf hingewiesen werden, die Intimsphäre der Eingeborenen zu achten. Im 19. Jahrhundert herrschte noch eine ungezwungene Zoo-Atmosphäre sowohl bei den Studienreisenden wie bei ihren Studienobjekten.
Und nahtlos geht es jetzt unter dem Stichwort Dýrafjörður ‒ Fjord der Tiere ‒ weiter, denn der Besuch des Prinzen beim trägen Geysir wird elegant mit Link übersprungen.
II. Abstecher in den Dýrafjörður
Sie werden sich sicherlich schon gefragt haben, liebe Leser, was denn die wahren Gründe waren, die den Prinzen nach Island getrieben hatten, denn Sie wissen, dass solche Staatsbesuche immer ein handfestes Ziel verfolgten ‒ Handel, Einflusssphären, Heiratsprojekte ‒ und verfolgen.
Der Prinz nahm Abschied von den begeisterten Reykjavíkern mit einer vielzitierten Rede: „Er sagte, die Dänen seien immer Freude Frankreichs gewesen … und die Franzosen erinnerten sich noch, wie die Dänen sich bemüht hätten, 1813 loyal zu sein.‟
Die Dänen hatten ihre strikte Neutralität wegen der zweifachen Angriffe der Briten auf Kopenhagen nicht durchhalten können, und sich auf die Seite Napoleons geschlagen, was ihnen 1813 den Staatsbankrott und ein Jahr später den Verlust Norwegens einbrachte. Nun aber, im Zuge des Krimkrieges hatten sich Frankreich und Großbritannien wieder zusammengetan, was die Dänen sicherlich mit einiger Besorgnis erfüllte. Was lag näher, als etwas Schönwetter in den dänischen Kolonien zu machen?
Nicht ohne den Isländern zu versichern, er wünsche ihnen bestes Wohlergehen, dampfte der Prinz weiter zu den nächsten Forschungsobjekten, der unbewohnten Insel Jan Mayen und Grönland. Doch plötzlich drehte die La Reine Hortense ab, nahm Kurs auf die isländischen Westfjorde und ankerte im abgelegenen Dýrafjörður. Begehrliche Blicke richteten sich dort auf das Haukadalur (nicht zu verwechseln mit jenem Haukadalur, das den Geysir und andere Springquellen beherbergt). Nein, an diesem Haukadal im Dýrafjörður hatte schon der Norweger und spätere Saga-Held Gísli Sursson Gefallen gefunden und sich dort niedergelassen. Selbstverständlich beabsichtigte Prinz Napoléon nicht, von Frankreich nach Island zu emigrieren, jedoch hatte auch er ein Siedlungsprojekt in der Tasche. Und manchem Isländer ging angesichts dieses Überraschungsbesuches ein Lichtlein auf.
Die Dänen hatten den Isländern 1787 Handelsfreiheit gewährt, allerdings standen dem kleinen, von Hunger und Umweltkatastrophen geplagten Völkchen nicht viele Mittel zur Verfügung, diese Freiheit zu nutzen. In offenen Booten gingen sie dem Fischfang in den Fjorden und im Küstenbereich nach, während ausländische Fischfangflotten etwas weiter draußen die dicksten Fische an Bord zogen ‒ eine Situation also, wie sie in vielen Regionen dieser Erde weiterhin Praxis ist. Einfahrt in die Fjorde und Landung war den ausländischen Schiffen nur in Notfällen erlaubt, allerdings fehlten Mittel und Personal, dies zu kontrollieren, und sowohl Dänemark wie die wenigen dänischen Verwaltungsbeamten in Island hatten wenig Interesse, hier einzugreifen.
Frankreich schickte Fischer aus der bettelarmen Bretagne ins Eismeer; sie kamen meist auf kleinen Zweimastschonern. Ab und an kam ein Schiff der französischen Marine vorbei:
„Der Kreuzer hatte jetzt gestoppt und war aus weitem Umkreis von der Plejade der Isländer umgeben. Von jedem ihrer Schiffe ward eine Nußschale von Boot herabgelassen, die langbärtige Männer in ziemlich wildem Aufzug an Bord brachten. Fast wie Kinder hatten sie alle um etwas zu bitten: um Verbandzeug für kleine Wunden, Flickzeug, Nahrungsmittel, Briefe.‟ (aus Pierre Loti: Die Islandfischer, verfasst 1886)
Als Isländer bezeichnen sich in der Erzählung des Marineoffiziers und Schriftsteller Pierre Loti die bretonischen Fischer selbst. Und in der Tat war ihre Situation kaum besser. Sie waren der offenen See schutzlos ausgeliefert, während die isländischen Fischer in ihren Nussschalen bei Sturm nur allzu oft kenterten, bevor sie den Heimathafen erreichten.
Die bretonischen Fischer müssen große Augen gemacht haben,als sie La Reine Hortense in den Dýrafjörður einlaufen sahen. Prinz Napoléons ging in der kleinen Handelsniederlassung Þingeyri an Land. „Der Prinz trat auch hier sehr liebenswürdig auf, verteilte verschiedene Geschenke und stach dann in See‟, berichteten die Zeitungen.
Nun war auch dem letzten Isländer klar, was der Prinz bezweckte, denn bereits im Jahre zuvor hatte der Kapitän des Kreuzers La Bayonnaise, der die französischen Fischerboote beaufsichtigte, das Alþingi, das isländische Parlament, im Auftrag verschiedener Kaufleute aus Dunkerque um Erlaubnis ersucht, eine Art Kolonie im Dýrafjörður zu errichten, um die Fänge gleich vor Ort verarbeiten zu können. Schuppen, Trockenplätze für den Kabeljau und Unterkünfte für die Arbeiter sollten dafür errichtet werden. Anfänglich war von 400-500 Männern die Rede, dann aber von einer vergrößerten Fischfangflotte (800-900 Schiffe mit 10.000 Mann Besatzung) und 1000 Arbeitern an Land ‒ es war der Plan, so empfanden es viele Isländer, den Dýrafjörður zur französischen Kolonie zu machen.
Und ein wenig erinnert der großzügige Auftritt des Prinzen an das Vorgehen gewisser Multikonzerne, die kommunalen Behörden ihre nicht gerade umweltfreundlichen Produktionsstätten für Aluminium, Silizium & Co. schmackhaft machten. Doch Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Isländer noch auf der Hut. Sie hatten zwar erreicht, dass ihr Alþingi wieder tagen konnte, doch ihre Unabhängigkeitsbestrebungen waren erst einmal gescheitert und Island blieb weiterhin dänische Kolonie. Und jetzt wollte Frankreich auch noch ein Stück des Landes kolonisieren ‒ das war zu viel. Bewohner und regionale Behörden im Bezirk Ísafjörður lehnten das Projekt in Bausch und Bogen ab, und in Þingeyri stellte man eine beachtliche Liste von Bedingungen auf, die u.a. Zölle, Gebühren für die Verarbeitung, Landnutzung und Rechtsstellung der französischen Arbeiter betrafen, auf die die Franzosen aber wohl niemals eingegangen wären. (Der Handelsplatz Þingeyri zahlte nach dem Zensus von 1855 gerade mal 14 Einwohner, von denen die Hälfte Kinder waren, während im Haukadalur auf drei Höfen immerhin 47 Menschen lebten.)
Während die Behörden in Dänemark keineswegs abgeneigt waren, den Franzosen die Lizenz zu erteilen, sammelte ein Ausschuss des Alþingi in jahrelanger Arbeit weitere Argumente, die gegen das Kolonialprojekt sprachen: Die Isländer würden gerade die ersten gedeckten Boote für den Kabeljau- und den Haifang einsetzen, konkurrenzfähig seien sie aber noch lange nicht. Auch befände sich das vorgesehene Land bei Þingeyri im Kirchenbesitz und es sei gänzlich ungewiss, auf welche Weise das Land verpachtet oder verkauft werden könne. So erfolgte schließlich der Ablehnungsbeschluss durch das Alþingi, den der dänische König zu Beginn der Fangsaison 1859 mit Brief und Siegel bestätigte.

Die französischen Fischer aber kamen bis ins frühe 20 Jahrhundert in die fischreichen Gewässer vor den isländischen Westfjorden. Nicht wenige Schoner kenterten, nicht wenige Männer verloren bei der harten und gefahrvollen Arbeit ihr Leben. Gegen eine Art Hafengebühr konnten die französischen Fischer schließlich doch in der Bucht Haukadalsbót ankern und mit den Einheimischen Waren tauschen ‒ sogar eine Mischsprache, das Haukadalsfranska, entstand. Die Toten durften an Land bestattet werden ‒ ein kleiner, sorgfältig restaurierter Friedhof am Rande des Haukadalurs zeugt noch heute davon. Ein Friedhof, wie ihn Pierre Loti beschrieb:
„In einem Fjord an der Küste gibt’s aber auch einen kleinen Gottesacker,‟ fuhr er fort. „Dort begraben wir die Leute, die während des Fischfangs an Bord sterben. Es ist geweihte Erde, so gut wie hier bei uns, und man setzt den Toten ein Holzkreuz mit dem Namen auf ihr Grab. …‟

Die Holzkreuze verwitterten, Namen und Zahlen der Toten haben sich verloren.
Aux sombres héros de l’amer
Qui ont su traverser les océans du vide,
A la mémoire de nos frères
Dont les sanglots si longs faisaient couler l’acide
|: Always lost in the sea
Tout part toujours dans les flots
Au fond des nuits sereines
Ne vois-tu rien venir ?
Les naufragés et leurs peines
Qui jetaient l’encre ici
Et arrêtaient d’écrire …
|: Always lost in the sea
Ami, qu’on crève d’une absence
Ou qu’on crève un abcès
C’est le poison qui coule.
Certains nageaient
Sous les lignes de flottaison intime
A l’intérieur des foules.
|: Always lost in the sea
Aux sombres héros de l’amer, Komposition von Noir Désir, einer französischen Rockband, 1989.