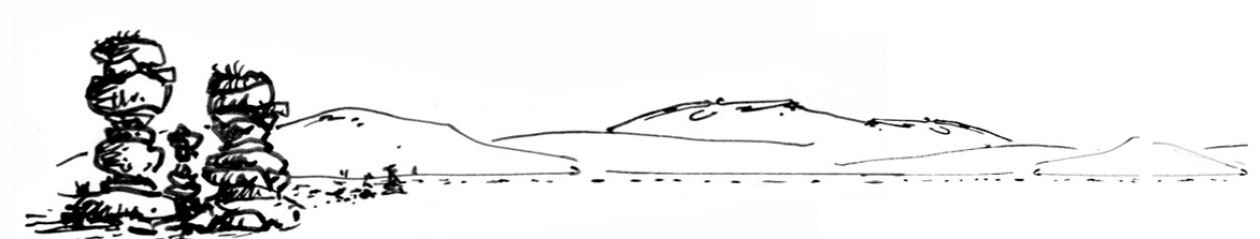Wie fast alle, die in Keflavík ankommen, war auch ich immer bestrebt, den Flughafen so schnell wie möglich zu verlassen und den Ort links liegen zu lassen. Vor rund zehn Jahren habe ich vor Rückflügen nach Deutschland in Keflavík übernachtet, einmal in einem winzig kleinen Holzhäuschen, das zweite Mal in einem heruntergekommenen Hostel. Lag das noch in Keflavík oder schon in Njarðvík? Die Orte gehen ineinander über und offiziell gibt es Keflavík gar nicht mehr. Alle Ansiedlungen rundum heißen nun Reykjanesbær (Rauchhalbinselstadt).
Keflavík gibt es nicht – so lautet auch eine Überschrift in Fische haben keine Beine, dem ersten Keflavík-Roman von Jón Kalman Stefánsson, den ich nun zum zweiten Mal lese.
Die Maschine landet, ich klappe das Buch zu. Neben mir ein geimpftes Pärchen, das sich erstmals einen Islandaufenthalt gönnt. Mir fehlt der bei Icelandair übliche Empfangsgruß Velkomin heim, denn diesmal fliege ich mit Lufthansa. Wir müssen sitzenbleiben, bis unsere Reihen aufgerufen werden, das übliche Aussteigechaos entfällt. Auf den ansonsten menschenleeren Gängen im Flughafen Keflavík erreiche ich das Ende der Warteschlange für den Covid-Test. Da entdecke ich sie wieder, die “Astronauten” (wollen sie auf der Halbinsel Reykjanes etwa eine Mondlandung simulieren?). Nein, es sind nur zwei in weiße Reinraumanzüge inklusive Schutzbrillen, Schuhüberzüge und Plastikhandschuhe gehüllte Covid-Phobiker, die schon am Frankfurter Flughafen für Erheiterung und Stirnrunzeln gesorgt haben.
Es ist der zweite Test innerhalb von zwei Tagen, zu dem ich nun antrete. Für den zu Einreise nötigen PCR-Test musste ich tags zuvor schon zum Frankfurter Flughafen. Es ging alles schnell, aber ich musste fast hundert Euro hinblättern, damit ich innerhalb von 12 Stunden das Ergebnis bekam.
Auf covid.is bin ich mit meiner Quarantäneadresse registriert, habe einen Barcode erhalten, der jetzt eingelesen wird. Auch die Papiere des Frankfurter Vortests, die man in Englisch vorlegen muss, werden geprüft. In Frankfurt wurden nur zwei tiefe Rachenabstriche gemacht, in Keflavík kommt jetzt eine Entnahme aus der Nase hinzu. Und das alles ganz kostenlos.
Es sind etwa vier Kilometer bis zu meiner privaten Quarantäneunterkunft in Keflavík. Ich dürfte ein Taxi nehmen, nicht aber den öffentlichen Bus. Ich ziehe den Fußweg entlang des Flughafenzauns vor, der abseits der Autostraße zum Stadtrand führt. Er ist allerdings durch einen Bagger versperrt, so dass ich den Koffer über holprige Umwege zerren muss.
Ich habe mich gut auf die fünf Quarantänetage vorbereitet, Desinfektionszeug, Wasserkocher, Müsli, Kartoffelbrei und andere Trockennahrung eingepackt, denn ich darf nicht in die Küche. Eine nicht separate Toilette zu benutzen, ist unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln erlaubt. Und was für mich das Wichtigste ist: Ich darf ¬ unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes – spazieren gehen.
Mein Quarantänezimmer verfügt über ein geräumiges Bett, einen Stuhl und eine nicht angeschlossene Tiefkühltruhe, die ich als Schreibtisch nutze. Das große Fenster bietet Ausblick auf die Straße und das Nachbarhaus.
Mein erster Ausflug führt mich zum nördlichen Hafenabschnitt, in dem kleinere Boote liegen. Dahinter erhebt sich eine Klippe, auf der ich einem Pfad entlang der Steilküste folge, bis hin zur nächsten Bucht, die den Ausblick auf die Müllverbrennungsanlage, eine Siliciumfabrik und die Zementtürme von Aalborg Portland eröffnet. Das motiviert nicht gerade zum Weiterwandern.
Der Wind pfeift mir heftig um die Ohren und lässt mich gelegentlich auch schwanken, so dass ich denke: Wenn jetzt die Erde bebt, was sie in den vergangenen Wochen hier ja oft genug getan hat, dann merke ich das gar nicht! Was ich nicht weiß, ist, dass die Bebentätigkeit bereits abnimmt, da am nächsten Abend die Erde im abgelegenen Geldingadalir aufreißen und Feuer spucken wird.
Vor Jahren habe ich auf der Halbinsel die brodelnden Schlammtöpfe bewundert, die den bekannteren Geothermalfeldern in der Mývatn-Region kaum nachstehen. Doch jetzt tritt über 1200°C heiße Magma aus Tiefen unterhalb der Erdkruste ans Tageslicht und formt ein ganzes Tal innerhalb von wenigen Tagen um. Seltsam, ich bin “vor Ort” (Luftlinie 20 km) und doch weit entfernt vom Geschehen. Auch ich muss in die Webcam glotzen, die Berichte lesen und kann nicht einfach mal hinwandern. Dabei wollen ihn alle sehen, den entstehenden neuen Vulkan. Denn fertig ist er erst, wenn er zu speien aufhört. Vorher erschafft er sich ständig neu. Reißt seine selbst aufgetürmten Kamine ein, bessert sie wieder mit erstarrender Lava aus und vereinigt sie vielleicht zu einem einzigen Schlot. Die Wissenschaftler vermuten, er will ein Schildvulkan werden, nicht so ein hoher und pyramidenförmiger, sondern ein breiter, behäbiger. Es kann lange dauern, bis seine Schöpfung vollendet ist.
Da anfangs niemand so recht weiß, wie man ins Geldingadalir, das Tal der Wallache kommt, herrscht in den ersten Tagen Orientierungslosigkeit und Tränen fließen. Wären die freiwilligen Helfer der Björgunarsveit nicht, die spezialisiert sind, aus Bergen, Seenot, Lawinen, Schneewehen, Lavafeldern etc. zu retten, würde das Chaos unaufhaltsam wachsen. Aber sie beginnen einen Wanderweg abzustecken, um die Massen, deren parkende Autos nun die ganze südliche Straße der Halbinsel blockieren, sicherer ins Geldingadalir zu geleiten.
Ja, ein bisschen neidisch bin ich auf die Eruptionsgucker, das muss ich zugeben. Ich erkunde inzwischen die Randbereiche und die nähere Umgebung von Keflavík. Ich muss nur manchmal Hundehaltern ausweichen oder ein paar Kindern, der Rest der Bewohner hält sich mehr ans Auto. Verständlicherweise, denn was Keflavík am meisten auszeichnet, ist der beständige starke Wind. Keflavík hat drei Himmelsrichtungen: den Wind, das Meer und die Ewigkeit, schreibt Jón Kalman Stefánsson.
Der Wind fegt die Wolken weg, die Sonne strahlt und wärmt für ein paar Minuten, dann serviert der Wind (ein hurtiger Kellner) einen Hagelschauer. Ich stelle mich wie ein geduldiges Islandpferd mit dem Hintern gegen den Wind, damit mir die Hagelkörner nicht das Gesicht zerkratzen, und warte auf den nächsten Sonnenstrahl. Ich stehe mitten auf einem uralten Lavafeld, gut bewachsen mit Heidekraut, Flechten, Moosen und Grashöckern, noch bucklig, aber nicht mehr scharfkantig und voll tückischer Spalten.
Am dritten Tag nach dem Ausbruch ist es dann soweit: Die Sicht ist klar und ich mache mich in der Dämmerung auf, wenigstens den Widerschein der Eruption am Horizont zu bestaunen. Die beiden Trolle Steinn og Sleggja (Stein und Hammer) haben ihn nicht gesehen und Sleggja blickt nur mondsüchtig übers Meer. Ich erklimme die Klippe über ihrer Höhle, die noch wegen Erdbebengefahr gesperrt wurde, und nun sehe ich den roten Schein, der sogar ein paar Wölkchen färbt. Ich habe nicht die Ausrüstung, ihn zu fotografieren, aber bei Best of Iceland kann man ihn aus dieser Perspektive bewundern.
Der Tag des abschließenden Covid-Testes bricht an, ein klarer, kalter Morgen, weiß überzuckert. Am zweiten Quarantänetag hatte mich eine Mitarbeiterin der Gesundheitsbehörden angerufen und auf die verschiedenen Möglichkeiten, wo ich den Test absolvieren könne, hingewiesen. Ich wählte das nächstgelegene Testzentrum in Njardvík. Der Weg führt mich am Meer entlang. Der Fischereihafen ist verödet, Spekulanten haben die Fangquoten verscheuert und die Trawlerflotte verrottet hinter dem Werftgelände. Auf einem Recyclinghof betrete ich eine zum Covid-Test-Zentrum umfunktionierte Halle. Obwohl ich nur fünf Minuten nach Öffnung eintreffe, bin ich die letzte in der Schlange, die von einer Gruppe junger Männern angeführt wird. Sie albern mit heruntergezogenen Masken herum, aber ich kann nicht hören, in welcher Sprache, und rätsele, ob es Touristen oder ausländische Arbeiter sind. Die Teststäbchen werden nicht so unangenehm weit eingeführt wie am Flughafen – offensichtlich gibt es da keine Norm.
Als ich zurückkomme, bricht mein Gastgeber auf, um die Eruption zu besichtigen. Ich kann leider nicht mitkommen, zumal dies kein Spaziergang ist, sondern eine Massenwanderung, auf der Abstandhalten nicht möglich ist.
Gegen vier Uhr nachmittags kommt die Nachricht auf der Nachverfolgungs-App Rakning C-19, dass mein Testergebnis negativ ist. Die Quarantänezeit ist damit offiziell beendet. Nun kann ich das Stadtzentrum und andere belebtere Plätze von Keflavík erkunden.
Am nächsten Tag, es ist Mittwoch, der 24. März, gibt es ernüchternde Meldungen: Da es in den letzten Tagen in Island, das seit Jahresbeginn nahezu covidfrei war, wieder zu gehäuften Fällen gekommen ist, darunter an einer Schule und unter Eruptionsbesuchern, treten ab dem folgenden Tag verschärfte Bestimmungen in Kraft. Für drei Wochen werden Schulen, Kindergärten, Sportstätten und Schwimmbäder (ich hatte mich schon so aufs Schwimmen und den Hotpot gefreut!) geschlossen. Eine schnelle konsequente Maßnahme, die mit Hilfe der in Island sehr effektiven Nachverfolgung hoffentlich bald zur Eindämmung des Virus führt.
Informationen für Reisende nach Ísland:
DE: Die Tracing-App Rakning C-19
FR: Appli de traçage Rakning C-19
EN: Travel to and within Iceland
EN: Violations of COVID-19 Quarantine
EN: Pre-registration for visiting Iceland
EN: App Rakning C-19
EN: Statistic