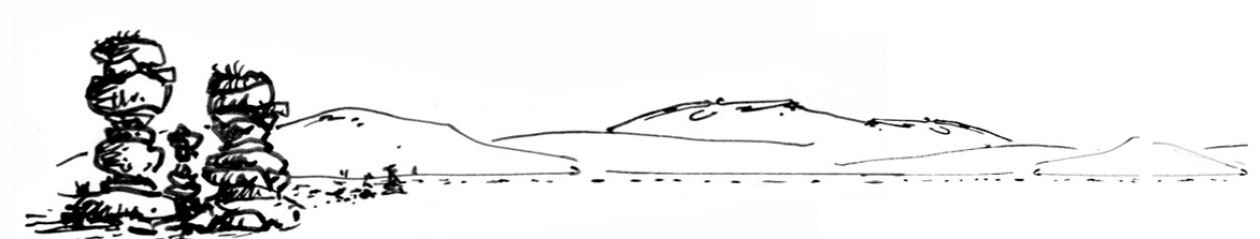Das gegen innere Widerstände mitgenommene Mobiltelefon habe ich – was gewiss kein Zufall ist – schon im ersten Hotel vergessen. Der Verlust hat nicht sehr geschmerzt, habe ich doch ein recht kritisches Verhältnis zu dieser „Errungenschaft“ der modernen Kommunikationstechnik: Ich finde, so ein Handy rundet die „emotionalen Ecken“ ab, Abschied und Wiedersehen zum Beispiel werden gar nicht mehr richtig durchlebt, durchlitten und genossen, wenn die kommunikative Nabelschnur niemals unterbrochen ist. Und wie kann man sagen: „Ich bin dann mal weg …“, wenn ständige Erreichbarkeit besteht?
Das gegen innere Widerstände mitgenommene Mobiltelefon habe ich – was gewiss kein Zufall ist – schon im ersten Hotel vergessen. Der Verlust hat nicht sehr geschmerzt, habe ich doch ein recht kritisches Verhältnis zu dieser „Errungenschaft“ der modernen Kommunikationstechnik: Ich finde, so ein Handy rundet die „emotionalen Ecken“ ab, Abschied und Wiedersehen zum Beispiel werden gar nicht mehr richtig durchlebt, durchlitten und genossen, wenn die kommunikative Nabelschnur niemals unterbrochen ist. Und wie kann man sagen: „Ich bin dann mal weg …“, wenn ständige Erreichbarkeit besteht?
Einen Fotoapparat habe ich von Anfang an gar nicht mitgenommen: Noch nie hatte ich auf einer derartigen Reise eine Kamera dabei, denn ich habe früh bemerkt, dass sie dazu verführt, die Welt ständig als Fotomotiv zu sehen und auf „Sehenswürdigkeiten“ zu reduzieren. Mir aber kam es darauf an, das fremde Land in seiner ganzen Buntheit und Vielfalt bewusst und ohne Ablenkung in mich aufzunehmen. (die besuchten „Sehenswürdigkeiten“ sind schließlich auf Postkarten erhältlich …) Nur so ist es möglich, an jedem Ort, den ich aufgesucht habe, tatsächlich gewesen zu sein. Und das Erlebte mache ich nicht durch Fotos, sondern durch Schreiben erinnerbar.
—
Wer allein eine Reise in ein fremdes Land unternimmt, tritt auch eine Reise zu sich selbst an. Unmittelbar und ungefiltert treffen Bilder, Geräusche, Gerüche und Gefühle auf die eigene Seele. Auf diese Weise spiegelt die fremde Umgebung das Ich mit seinen moralischen und kulturellen Wertvorstellungen, bisherigen Erfahrungen, seinen (Vor-)urteilen, Vorlieben und Abneigungen und eröffnet so eine neue Sicht auf die eigene Existenz und auf die umgebende Welt: Die Begegnung mit einer fremden Welt wird zur Selbstbegegnung. Liegt doch das Eigene meist im toten Winkel der Wahrnehmung.
—
Der allein Reisende ist weitgehend Herr über Zeit und Raum – welch beglückendes Erlebnis, wo unser Leben heutzutage doch bis ins Detail strukturiert ist von Uhren, Fahrplänen, Ampeln, Fußgängerüberwegen, Vereinbarungen, Verabredungen, Terminen … und nur der Reisende selbst bestimmt die Richtung, in die er sich bewegt, die Neugier weist ihm den Weg, er kann sich treiben lassen von Lust- und Unlustgefühlen. Und es spielt keine Rolle, ob er müde geworden ist, oder über die Energie für weitere Stunden des Umherwanderns verfügt – kann er doch rasten, wann immer und so lange er will!
—
Nach eineinhalb Stunden kündigt sich die türkisch-syrische Grenze durch kilometerlange Lastwagenkolonnen an. Das Verhältnis der beiden Länder hat sich in letzter Zeit wesentlich verbessert, der Handel ist nun rege und dementsprechend geht es an der Grenze mit ihren Formalitäten zu. Unser Fahrer wuselt listig rechts und links an den Kolonnen vorbei, schimpft, und wird beschimpft, und schon stehen wir vor dem Abfertigungsgebäude an der Grenze. Alle müssen aussteigen, zur Passkontrolle. Unser Fahrer geht durch den Bus und sammelt alle türkischen Pässe ein. Ich sage: „Ich bin Deutscher, nicht Türke“. Er zwinkert mir zu: „Jetzt bist du auch mal Türke“, nimmt meinen Pass und verschwindet im Laufschritt in der Abfertigungshalle. Ich, etwas besorgt, hinterher. Aber schon ist er in irgendwelchen Büros verschwunden mit seinen türkischen Pässen. Während die anderen ausländischen Mitreisenden die Einreiseformulare ausfüllen, kann ich mich in Ruhe umschauen. Das Gebäude ist ziemlich neu und sehr gepflegt, es herrscht eine ruhige Atmosphäre; natürlich blickt das Konterfei des – wie ich finde – „chaplinesk“ drein schauende Präsidenten, der von nun an allgegenwärtig sein wird in diesem Land, gleich mehrfach von der Wand. Und dann fällt mein Blick auf ein großes Schild: „Verehrte Einreisende“, heißt es da, „sollte sich einer unserer Beamten nicht korrekt verhalten oder in irgendeiner Weise Anlass zu Beschwerde geben, so wenden Sie sich bitte an den zuständigen Aufsichtsbeamten oder rufen Sie die Telefonnummer … an.“ Da fällt mir ein, was mir bei der Einreise am Flughafen in Baltimore (USA) vor einigen Jahren als erstes auffiel: Ein Schild, das in rüdem Ton darauf verwies, dass es ein strafbewehrtes Vergehen sei, bei der Passkontrolle eine Diskussion zu führen („to argue with an immigration officer“). Welch ein Kontrast zwischen dem Land, das angeblich ein Hort der Finsternis sein soll einerseits, und dem gelobten Land der Freien und Gleichen andererseits …
Allepo

Am Ende der Gasse eine nun lebhafte Straße. Hier kommen viele Taxis an und vor allem auch große Touristenbusse. Ich setze mich auf eine Mauer an der Moschee und betrachte das Treiben. Gerade quellen etwa 40 Touristen aus Deutschland aus einem der Busse; kaum setzen sie den Fuß auf die Straße, reißen die meisten von ihnen die Kamera vors Auge und „schießen“ wie wild um sich. Manche fahren mit ihrem Camcorder einen raschen 360-Grad-Schwenk um die eigene Achse. Die Reiseführerin weist auf drei renovierte Holzhäuser hin (wie ich sie bereits in großer Zahl auf meiner Wanderung heute früh gesehen habe), und schon richten sich alle Kameras auf diese drei Gebäude. Es scheint aber niemand richtig hin zu schauen, vielmehr gilt die ganze Aufmerksamkeit der Entdeckung weiterer Fotomotive. Ich stelle mir vor, dass viele der hier Anwesenden möglicher Weise erst auf dem Sofa daheim, wenn sie die Fotos betrachten, zum ersten Mal all das Schöne zur Kenntnis nehmen, das sie hier vor Ort offenbar nicht richtig in sich aufnehmen (können). Die Reiseführerin erzählt dann offenbar noch vieles mehr, aber es hören nur ein halbes Dutzend wirklich zu, die anderen haben sich abgewendet, fotografieren, gucken sich am Straßenrand angebotene Souvenirs an, trinken aus mitgebrachten Wasserflaschen und wischen sich den Schweiß von der Stirn. Und reden viel. Ich frage mich, warum diese Leute überhaupt eine doch sicherlich nicht billige „Bildungsreise“ gebucht haben. Als ich der Gruppe nachschaue, wie sie sich nun, hinter dem Fähnlein der Reiseführerin versammelt, den Hügel zur Zitadelle hinauf schleppt (die Zufahrt von hier aus ist für Busse gesperrt), denke ich daran, wie gut ich’s doch habe … ich nämlich kann es mir erlauben, hier zu sitzen und zu staunen solange ich mag, um an diesem ersten Tag erst einmal die Stadt als Ganzes mit allen Sinnen in mich auf zu nehmen; Zitadelle und Moschee und all die anderen Sehenswürdigkeiten können warten, sie sind ja schon viele hundert Jahre und auch morgen noch da …
—
Es ist – nach vielen unguten Erfahrungen in anderen Ländern – unglaublich, wie unbehelligt ich mich als Tourist in diesem Land bewegen kann: Keinerlei lästige oder aufdringliche „Anmache“, niemand zupft am Ärmel, niemand will einem irgendwelche „echt antike“ Schätze verhökern, einen Teppich verkaufen, die Schwester anbieten, illegal Geld wechseln oder einfach nur „guide“ sein! Welch ein Gegensatz zu Ländern wie Ägypten oder Marokko! Wende ich mich aber Auskunft suchend an einen Passanten, so überschlägt sich der vor lauter Hilfsbereitschaft! Die Verständigung ist zwar in aller Regel schwierig, nur die Wenigsten können Englisch oder Französisch, im Lesen eines Lageplans sind die Syrer auch nicht gerade Weltmeister – aber sie sind herzlich und freundlich und immer sind sie bemüht, dem Fragenden eine Antwort zu geben (die sich bisweilen später als falsch heraus stellt, vermutlich, weil es in den Augen eines Syrers immer noch besser ist, eine unzutreffende Auskunft zu geben, als gar keine.) Als ich in einer überfüllten Bank Geld wechseln möchte und mich hilflos umschaue, komme ich mit einem Mann ins Gespräch, der einmal ein paar Jahre in Dortmund gearbeitet hat und noch recht gut deutsch spricht. Er nimmt sich viel Zeit für mich, lotst mich an langen Warteschlangen vorbei, redet mit dem Schalterbeamten, lässt sich nicht abwimmeln, und ich bekomme meine syrischen Pfund. Herzlich verabschiedet er sich von mir, wie von einem alten Freund. Abends, als ich am Sahat Hatab, dem kleinen Platz in der Nähe meines Hotels einen „sundowner“ genieße, kommt plötzlich dieser Mann aus der Bank vorbei, an der Hand seine zwei kleinen Töchter, etwa im Alter von 8-10 Jahren. Eine von ihnen ist behindert. Der Mann zeigt sich ehrlich erfreut, mich wieder zu sehen. Ich bin es auch. Die beiden Mädchen geben wohlerzogen die Hand, wir wechseln ein paar Worte, dann muss er weiter, seine Frau wartet. Mit einer Umarmung verabschiedet sich der Mann, wie es üblich ist in diesem Land. An diese Begegnung muss ich oft denken: Wie schnell kann sich manchmal ein herzlicher Kontakt zwischen Menschen ergeben, die sich völlig fremd waren! Und es fällt mir das Zitat aus dem „Kleinen Prinzen“ ein, „Man sieht nur gut mit dem Herzen“.
—-
Der nächste Tag ist ein Sonntag. Früh werde ich geweckt – nein, nicht vom Ruf des Muezzin, sondern vom Glockengeläut der im 19. Jahrhundert gebauten katholischen Kirche hinter dem Hotel! Tja, in Syrien ist möglich, was im Deutschland von Herrn Sarazzin undenkbar ist. Man stelle sich nur einmal vor, einen Steinwurf von Münchens Marienplatz entfernt riefe am Morgen der Muezzin zum Gebet! Beschämt muss ich mir eingestehen, dass für den größten Teil meiner deutschen Mitbürger eine solche Vorstellung wohl unerträglich ist.
—
Es ist wohl die „Ganzheit“ menschlichen Lebens, das Neben- und Miteinander von Produktion, Handel, Wohnen, geselliger Zerstreuung, Erholung und religiöser Hingabe. Wohnung, Werkstadt, Geschäft, Teestube, Moschee und Hamam – alles ist in Reichweite, kaum getrennt. Ein Nebeneinander auch der Generationen: Greise, die an der Türschwelle sitzen und Horden spielender Kinder in den Gassen. All das, was wir der Moderne geopfert haben, suchen wir nun sehnsüchtig wieder zu finden in fernen Ländern. Wohnen wir doch in „Schlafstädten“, arbeiten in Industriezonen oder Bürohäusern, kaufen in Einkaufszentren, entspannen uns im Vergnügungsviertel, erholen uns im „Wellness-Centre“, besuchen unsere Alten im Altenheim und verbannen unsere Kinder auf Spielplätze, Kirchen brauchen wir schon lange nicht mehr … Alles ist getrennt, funktional, effizient, raum-, geld-, zeitsparend organisiert. Das menschliche Dasein, es ist in Segmente zerfallen und es wird immer schwerer, die Einzelteile zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzufügen.

An diesem letzten Abend in Aleppo sitze ich noch einmal in der Nähe meines Hotels vor dem „Café Sissi“ am Sahat Hatab-Platz, der mich mit seinem Flair ein wenig an Montmartre oder auch Alt-Schwabing erinnert. Hier wird mir bewusst, dass Aleppo auch heute noch eine Schnittstelle ist zwischen Tradition und Moderne, zwischen Okzident und Orient, zwischen verschiedenen Kulturen. Fast so wie ich Beirut erlebt habe vor dem Krieg von 1975. Um mich herum sitzen ganz unterschiedliche Menschen: Das syrische Paar mittleren Alters, mit dem ich mich französisch unterhalten kann, er trinkt (in aller Öffentlichkeit!) ein Bier, sie telefoniert mit ihrem Mobiltelefon. Dann sind da zwei junge Frauen, beide tragen Kopftuch – und rauchen, sich lebhaft unterhaltend, Wasserpfeife (auch das in aller Öffentlichkeit)! Und dann ist da eine westlich gekleidete, offenbar gut betuchte Dame, die – einen Hund (!!!) an der Leine – mit einem Begleiter am Nebentisch Platz nimmt. Das ist etwas Unerhörtes, denn für einen Muslim ist der Hund, neben dem Schwein, ein unreines Tier, dessen Nähe der Mensch meidet. Der Hund und seine Herrin erregen denn auch große Aufmerksamkeit, die Buben, die in der Mitte des Platzes Fußball gespielt haben, unterbrechen ihr Spiel und stehen bald belustigt tuschelnd, und gleichzeitig ungläubig staunend in einiger Entfernung um den Tisch, an dem sich Hund und Mensch niedergelassen haben. Auch die Passanten, die vorbei kommen, werfen verstohlene Blicke auf den Hund, der es sich unter dem Stuhl seiner Herrin gemütlich gemacht hat. Da fällt mir das Kapitel „Ich, der Hund“ in Orhan Pamuks Roman „Rot ist mein Name“ ein, das die Existenz der Gattung Hund aus der Sicht eines Hundes in Istanbul mit umwerfender Komik beschrieben hat. Und es fällt mir zum ersten Mal auf, dass ich seit meiner Abreise aus Deutschland vor 14 Tagen nicht einen einzigen Hund zu Gesicht bekommen habe, bis heute Abend.
—
Wenn ich die drei Tage, die ich nun in Aleppo verbracht habe, Revue passieren lasse, so bin ich einiger Massen verwirrt. Was ich sah, entspricht so gar nicht dem Klischee vom „bösen Islam“, vom „Ort der Finsternis“, „der Achse des Bösen“, die Syrien doch sein soll – wenn man Psychopathen wie Ronald Reagan, George W. Bush, Herrn Sarrazin, etc. glauben will. Nun könnte man mir entgegnen: Syrien und vor allem Aleppo ist ja nicht „typisch“! Aber warum soll immer nur „typisch“ sein, was dem Vorurteil entspricht? Könnte man nicht auch argumentieren, dass Aleppo „typisch“ ist für die kulturelle und religiöse Toleranz, die eben auch anzutreffen ist in den Ländern des Nahen Ostens?
—
Etwa vier Monate, nachdem ich aus dem mir so liebenswert erscheinenden Land zurückgekehrt war, kamen erschreckende Bilder aus Syrien: Bilder von Panzern und Soldaten in den Städten, Frauen und Kinder auf der Flucht, blutüberströmte Demonstranten und brennende Geschäfte … Wie mag es nun den vielen netten Menschen ergehen, die ich auf meiner Reise kennen gelernt hatte? Sind sie alle noch unversehrt?