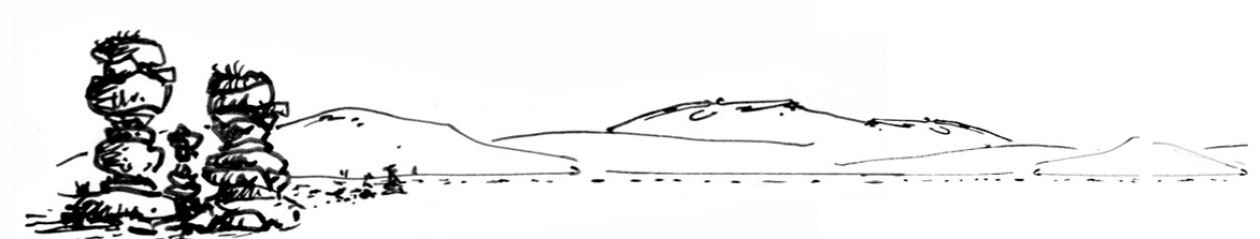„Hören Sie gut zu und wiederholen Sie!!!“ sei der Satz gewesen, der sich ihm eingeprägt habe, als er sich anschickte, die deutsche Sprache zu erlernen. Böse Zungen behaupten, er hätte sich damit bereits das Wesentliche gemerkt, was deutsche Schulen ausmache wie auszeichne. Dass dem so nicht ist, sei am Beispiel einer Stadt wie Bielefeld nachgewiesen. Es könnte aber auch eine andere deutsche Stadt sein, zum Beispiel Bonn, oder jede andere Stadt, so diese nur ca. 320.000 Einwohner zählte. Nehmen wir also eine von diesen Städten, nehmen wir Bielefeld, als Stellvertreter für all solche deutschen Städte, welche die Eigenschaft besitzt, dass in ihr ca. 320.000 Einwohner einen Wohnsitz haben.
„Hören Sie gut zu und wiederholen Sie!!!“ sei der Satz gewesen, der sich ihm eingeprägt habe, als er sich anschickte, die deutsche Sprache zu erlernen. Böse Zungen behaupten, er hätte sich damit bereits das Wesentliche gemerkt, was deutsche Schulen ausmache wie auszeichne. Dass dem so nicht ist, sei am Beispiel einer Stadt wie Bielefeld nachgewiesen. Es könnte aber auch eine andere deutsche Stadt sein, zum Beispiel Bonn, oder jede andere Stadt, so diese nur ca. 320.000 Einwohner zählte. Nehmen wir also eine von diesen Städten, nehmen wir Bielefeld, als Stellvertreter für all solche deutschen Städte, welche die Eigenschaft besitzt, dass in ihr ca. 320.000 Einwohner einen Wohnsitz haben.
Die Stadt der Dichter und Leser
 Es gibt in Bielefeld 129 Verlage, die 2010 insgesamt 1.505 verschiedene Bücher publiziertem, davon allein 350 Bücher im Bereich Literatur/Dichtung, aus Übersetzungen von Literatur und Dichtung anderer Länder weitere 286 Bücher, im Bereich Philosophie 16 Bücher von Philosophen der Stadt, sowie weitere 15 Bücher aus Übersetzungen von Werken ausländischer Philosophen.
Es gibt in Bielefeld 129 Verlage, die 2010 insgesamt 1.505 verschiedene Bücher publiziertem, davon allein 350 Bücher im Bereich Literatur/Dichtung, aus Übersetzungen von Literatur und Dichtung anderer Länder weitere 286 Bücher, im Bereich Philosophie 16 Bücher von Philosophen der Stadt, sowie weitere 15 Bücher aus Übersetzungen von Werken ausländischer Philosophen.
Diese Werke der Bielefelder Autoren und Übersetzer werden von Druckereien gedruckt, von Buchbindern gebunden, und dann werden die 1.505 Auflagen an die 26 Bielefelder Buchhandlungen ausgeliefert, damit die Bielefelder mit Lesestoff versorgt werden, auf welchen diese schon sehnsüchtig warten, um in langen Winternächten ihrer Leidenschaft nachgehen zu können: In einem Buch zu lesen. Und da ein Buch in Bielefeld nur dann Buch ist, wenn Werk von Dichter sich vereint mit Werk von Buchgestaltern, Werk von Druckern, Werk von Buchbindern, und Kenntnis von Buchhändlern, wird verständlich, dass die Bielefelder unter der Tätigkeit „lesen“ etwas anderes verstehen als ein Scannen von Zeilen und das Konsumieren von Texten;. sie daher Jahr für Jahr auf die neue Bücherflut warten, und sich überraschen lassen, von all dem Neuen, bisher noch nicht Dagewesenen, um sich darin zu versenken.
Da dies in Bielefeld so ist, entstand dort eine Gemeinschaft all jener, die mit der Herstellung von Büchern zu tun haben: Der Bielefelder Schriftstellerverband, der eine Autorengewerkschaft ist, und dessen Aufgabe darin besteht, die Freiheit der Literatur zu schützen. Dieser Verband kümmert sich um Regelwerke mit Herausgebern, Theatern, Medien, Institutionen und anderen Einrichtungen, die die Werke herausgeben oder verwenden wollen.
Und so leben in Bielefeld 70 Autoren allein von ihrer schriftstellerischen Tätigkeit, die Stadt zahlt Provisionen an einen speziell dafür eingerichteten Fond für die Benutzung von Büchern in öffentlichen Bibliotheken, und für die Verwendung von Texten als Lehrmaterial in den Schulen der Stadt.
Der Stellenwert von Dichtkunst und Literatur ist in Bielefeld so hoch, dass die Molkerei der Stadt einen Dichter-Wettbewerb unter den Schülern der Stadt auslobte, und dann die Gedichte der Kinder auf den Tetra Paks publizierte. So konnten die Bielefelder Familien morgens beim Frühstück ihren Tag mit dem Lesen eines Gedichts anreichern, mit Gedichten von Schülern, wie zum Beispiel diesem:
„Damals
war ich so glücklich
ihn zu peinigen
und keiner
wagte mich anzuklagen.
Jetzt
sah ich ihn heute,
er ist berühmt.
Ich beneide ihn;
was bin ich?
Nichts!“
„Willkommen in der Stadt“
Es kann daher auch nicht überraschen, dass sich der Bürgermeister der Stadt schriftlich an die Besucher der Stadt wendet, an die Touristen, indem er darauf hinweist, dass die Wahrscheinlichkeit nicht groß ist, dass diese in der Stadt sind, da der größte Teil der Menschheit anderswo sei, und dies wissenschaftlich erwiesen ist:
„Ist es ein Zufall, wo man geboren wird? Ist es Gegenstand eines allgemeinen Gesetzes? Habe ich in irgendeiner Form existiert, bevor ich geboren wurde? Hatte ich etwas damit zu tun, wo ich geboren wurde? Warum haben Eva Braun und Adolf Hitler keine Kinder geboren? Haben sie es nicht versucht? Kann es sein, dass kein Kind sie als Eltern wollte? Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube nicht, dass Gott Würfel spielt, vor allem nicht, wenn Menschenleben betroffen sind. Diese Gedanken führen einen unweigerlich dazu, Schrödingers Katze zu betrachten. Sie ist wahrscheinlich eine der berühmtesten Katzen der Welt (vielleicht nach Ninja Cat). Noch weiß niemand, wie sie genannt wurde? Wie wurde Schrödingers Katze genannt? Abrakadabra? Ich erinnere mich nicht. Nennen wir sie Phoenix. Das ist eine gebräuchliche Bezeichnung für Katzen. Phoenix war von der Art, dass sie sowohl existierte und auch nicht. Deshalb existierte sie immer, und selbst wenn Schrödinger seine Katze in einer eher geschmacklosen Weise getötet hätte, ist sie immer noch in Schrödinger’s Haus am Leben, während Schrödinger selbst seit längerer Zeit tot ist:
Δx Δp ≥ h/2
Bedeutet dies, dass ich immer existierte, oder dass ich nie existierte und daher auch jetzt nicht existiere? Das kann nicht sein! Es würde bedeuten, dass all unsere Existenz irreal war und nur in unserer eigenen Phantasie existierte. Wenn ich nicht existiere, dann du auch nicht. Ich hatte eine harte Zeit, das zu glauben. Die Fakten sprechen für sich. Wenn ich nicht wirklich bin, dann, wie könnte ich dann nach Finnland fliegen, mir eine Postkarte mit einem Bild von der finnischen Präsidentin Tarja Halonen zusenden, wieder nach Hause fliegen und den Briefträger begrüßen, der mir die Karte bringt? Ich weiß nicht.“
„Der Vater ein Alkoholiker, und die Mutter war immer müde“
„Man kann die Nation mit einer Familie vergleichen, mit einem Alkoholiker als Vater, der seit vielen Jahren betrunken ist …Er hatte große Ideen, vor allem, wenn er einige hatte. Er hatte einen Mund und scheute sich nicht, den Leuten zu sagen, wohin sie gehen sollten … ‚Ich höre keinerlei Bullshit zu!‘ war sein Motto, und seine Familie vertraute ihm. Zum Teil, weil die Familie ihn liebte, trotz seiner Trinkerei und seiner Fehler, aber auch zum Teil, weil die Leute einfach Angst hatten, sich gegen ihn zu stellen. Und so begann die Familie sich zu fragen, ob er eine Art von Genie sei und kein psychisch kranker Alkoholiker, sondern brillant, der fähig ist, Dinge zu sehen, für die die durchschnittlichen Verlierer nicht klug genug waren, sie zu sehen … Am Ende konnte er nichts mehr tun als den geistigen, körperlichen und finanziellen Ruin zu gestehen. Und so ging er in Behandlung. Und die Familie blieb verblüfft, verwirrt und wütend zurück“.
So die Rede des Bürgermeisters zur zweiten Diskussion zum Jahresbudget der Stadt, und die Staatsbürger der Nation lobten die Rede, indem sie die Ausführungen als „erschreckend genau“ bezeichneten. Aber der Bürgermeister warnte vor dieser Wut, da sie Energie „verbrenne“ und zu Erschöpfung führe, denn Gram und Hoffnungslosigkeit führe zu Inaktivität. Ärger sei menschlich und manchmal notwendig, aber wenn zugelassen werde, dass er sich anhäuft, werde dies zu einem tödlichen Gift, das den Geist krankmache. So der Bürgermeister, der in seiner Ansprache zur Ankündigung des vorgeschlagenen Stadthaushalts bereits ankündigte:
„Wir teilen keine vorgegebene, gemeinsame Ideologie. Wir sind weder rechts noch links. Wir sind beides. Wir wissen nicht einmal, dass es darauf ankommt … Wie oft kann der Kuchen geschnitten werden? Wer bekommt ein kleines Stück? Und wer braucht ein wirklich großes Stück? Was ist ein Luxus, und was ist wichtig? … Ist es besser, die Kinder an Stelle der Älteren zu berauben?“
Der ehrenhafteste Politiker des Landes
 Spätestens an diesem Punkt wäre hier klarzustellen, dass es sich bei diesem Bericht keineswegs um eine Stadt handelt, sondern um eine ganze Nation, deren Anzahl an Staatsbürger nicht größer ist als eben die Einwohnerzahl einer Stadt wie zum Beispiel Bielefeld. Und die Rede ist von einem Bürgermeister einer Stadt, der den Namen Jón Gnarr angenommen hatte, und dessen Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Reykjavik bereits endete, in welcher er 8.000 Angestellten der Stadt vorstand. Die Amtszeit endete nicht, weil er nicht mehr gewählt worden wäre. Keineswegs. Bereits nach einem Jahr Amtszeit bescheinigte ihm die Nation, der ehrenwerteste Politiker des Landes zu sein. Laut Nachricht der Tageszeitung Morgunblaðið vom 11.03.2011 erreichte Jón Gnarr nach einem Jahr Amtszeit im Vergleich mit anderen politischen Persönlichkeiten Islands den Spitzenplatz in Ehrlichkeit (28,8 %), Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft (23,7 %), Ausstattung mit Persönlichkeit (29,5 %), und bildete in Entschlossenheit (5,0 %), Machtstellung (5,6 %), Standhaftigkeit gegenüber seinen Überzeugungen (17,9 %) und Funktionstüchtigkeit bei Druck (3,5 %) das Schlusslicht, galt damit als die ehrenhafteste und ehrenwerteste Person Islands.
Spätestens an diesem Punkt wäre hier klarzustellen, dass es sich bei diesem Bericht keineswegs um eine Stadt handelt, sondern um eine ganze Nation, deren Anzahl an Staatsbürger nicht größer ist als eben die Einwohnerzahl einer Stadt wie zum Beispiel Bielefeld. Und die Rede ist von einem Bürgermeister einer Stadt, der den Namen Jón Gnarr angenommen hatte, und dessen Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Reykjavik bereits endete, in welcher er 8.000 Angestellten der Stadt vorstand. Die Amtszeit endete nicht, weil er nicht mehr gewählt worden wäre. Keineswegs. Bereits nach einem Jahr Amtszeit bescheinigte ihm die Nation, der ehrenwerteste Politiker des Landes zu sein. Laut Nachricht der Tageszeitung Morgunblaðið vom 11.03.2011 erreichte Jón Gnarr nach einem Jahr Amtszeit im Vergleich mit anderen politischen Persönlichkeiten Islands den Spitzenplatz in Ehrlichkeit (28,8 %), Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft (23,7 %), Ausstattung mit Persönlichkeit (29,5 %), und bildete in Entschlossenheit (5,0 %), Machtstellung (5,6 %), Standhaftigkeit gegenüber seinen Überzeugungen (17,9 %) und Funktionstüchtigkeit bei Druck (3,5 %) das Schlusslicht, galt damit als die ehrenhafteste und ehrenwerteste Person Islands.
Eine Bewertung, die geeignet ist für Irritationen: Sind es nicht eben die Eigenschaften „Entschlossenheit“, „Machtstellung“, „Standhaftigkeit gegenüber seinen Überzeugungen“ und „Funktionstüchtigkeit bei Druck“, welche Politiker auszeichne und diese erst zu solchen mache, und seien diese nun – was diesbezüglich Jacke wie Hose – in einer Diktatur oder Demokratie unterwegs, ob dort nun säkular oder auch nicht? Und ist damit gesagt, dass Politiker nur dann Politiker sind, wenn diese ehrlich sind, mit der Gemeinschaft zusammenarbeiten, und mit Persönlichkeit ausgestattet sind?
Und so endet die Rede Jón Gnarr’s zur Diskussion über das Jahresbudget der Stadt:
„Miss Reykjavík hat eine Zukunft vor sich. Sie hat vielleicht einen Alkoholiker als Vater gehabt und ihre Mutter war immer müde. Doch sie lässt es dabei nicht bewenden. Sie verzeiht alles, duldet alles, und streckt sich zum Licht. Reykjavík hat das Potenzial, die sauberste und schönste, friedvollste und lebenslustigste Stadt der Welt zu sein, weltbekannt für Sympathie, Kultur, Natur und Frieden; ein Diamant, für uns zu polieren und zu glänzen„.
Der „Komiker“
Was ist ein „Komiker“? Lassen wir Jón Gnarr selbst zu Wort kommen:
„Vor einem Jahr saß ich auf der Insel Puerto Rico. Ich hatte gerade einen Kinofilm fertiggestellt, zu dem ich das Drehbuch schrieb und den ich zusammen mit ein paar meiner Freunde produziert hatte. Ich war arbeitslos und frage mich, was mein nächstes Projekt sein soll.
Ich war zuvor bei einer Werbeagentur beschäftigt, wurde aber im Gefolge der Rezession und Depression entlassen. Ich verfolgte die Situation in Island über die Nachrichten-Websites. Es wurde zur Gewohnheit nach dem Zusammenbruch. Vor dem Zusammenbruch hatte ich wenig Interesse an Politik, und ich ging sogar einige Längen, um zu vermeiden, dem Treiben in dieser Ecke der Gesellschaft folgen zu müssen.
Ich tat dies, bis alles mit einem Krach zusammenbrach und unser Premierminister im Fernsehen auftrat, um Gott zu bitten, uns zu segnen. Ich fühlte mich wie mit einem nassen Lappen geohrfeigt. Was war geschehen? Ich begann im Anschluss daran die Nachrichten aufmerksam zu verfolgen. Wo ich ging, drehte sich der Diskurs überall um dieses Thema; auf Parties, bei Geschäften und bei Treffen mit Freunden auf der Straße.
In einem Augenblick wurde ich ein Nachrichten-Süchtling. Und je mehr ich den Nachrichten folgte, umso wütender wurde ich. Ich war wütend auf die kapitalistischen Bankster. Ich war auf das System wütend, das versagte. Aber ich hob meinen heftigsten Zorn für die Politiker auf. Jeder einzelne von ihnen ist ein unfähiger, eigennütziger Idiot, dachte ich.
Ich war wütend auf mich, und böse auf die Menschen, die diese Politiker gewählt hatten. Ich wollte etwas tun. Ein paar Mal ging ich hinunter zur Austurvöllur, um mich an den Protesten zu beteiligen. Ich konnte mich zur uneingeschränkten Teilnahme nicht entschließen. Ich wollte nicht Müll in das Alþing werfen oder mit der Polizei ringen. Ich wollte meine Wut nicht durch die Eröffnung eines Blogs entlüften.
Ich bekam von all dem Ärger Angst, von der Wut in mir und die mich umgebende Wut. Ich war besorgt, dass sie sich verstärkt und wächst und am Ende etwas Schreckliches passieren würde. Ich fühlte den Schmerz aller. Ich fühlte mit den Menschen, die in ihrem Protest Zeichen schwangen und auf Töpfe schlugen. Aber ich fühlte auch mit den ängstlichen Politikern, die in übereilter Flucht zu ihren Autos liefen oder mit Angst in ihren Augen vor den Kameras standen. Ich fühlte mit den Polizeibeamten, die die wütenden Massen vor dem Gesicht hatten. Mein Vater lag damals auf seinem Sterbebett im Landeskrankenhaus. Er war seit über vierzig Jahren ein Polizist Reykjavík’s. Er wurde in all den Jahren nicht in einen höheren Rang befördert, weil er Kommunist war. Ich fand es traurig, dass er starb und es ihm entgangen ist, dass die Links-Grünen in das Alþing kamen. Das hätte ihn sehr glücklich gemacht.
Ich liebe diese Stadt und ich liebe dieses Land. Ich liebe die Menschen, die es bewohnen.“
Was die Frage aufwerfe, welcher Sinn darin liege, die Größe einer Nation an der Anzahl Staatsbürger zu bemessen.
Die Frankfurter Rundschau titelte: „Ein Clown macht Ernst“, und Henryk M. Broder berichtete live aus Reykjavik „Reykjavik erwartet den Staats-Streich“.
Der „Clown“ Jón hat das Rathaus von Reykjavik an seinen Nachfolger übergeben, der „Staatsstreich“ ist zu Ende. Jedoch: War er ein Clown? War es ein Staatsstreich?
Übersetzung: B. Pangerl